Zwischenruf aus der Praxis
Offene Worte in bewegten und bewegenden Zeiten
Rasch und fundiert urteilen - das erste "Hinterkopf-Modell" FSD
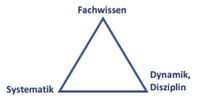
Führen heißt u.a. urteilen. Als Führungskraft kennen Sie das und müssen es ständig tun: Sie haben eine Person vor sich, oder eine Gruppe von Personen, Sie hören das Konzept einer Gruppe, Sie erleben die Arbeit in einer Abteilung oder in einem Fertigungsbereich oder Sie besuchen einen Ihrer Standorte oder Lieferanten. In jeder dieser Situationen müssen Sie rasch urteilen: wie gut ist die Person, sind die Personen oder wie gut ist das vorgestellte Konzept, wie gut wird die Arbeit erledigt und wie gut ist die Performance des Standorts oder des Lieferanten?
Wie kommen Sie zu Ihrem Urteil? In solch einer Situation können Sie kein Handbuch auspacken oder Daten in ein Programm eingeben. Was Sie in einer Situation brauchen, ist ein einfaches, aber intelligentes Modell "im Hinterkopf", eine "Heuristik", das Ihnen hilft, das Urteil rasch und fundiert zu treffen. Beim Urteilen über Personen oder Gruppen unterscheidet man zwei Dimensionen, die Sachebene, die "hard facts", sowie die emotionale Ebene, die "soft facts".
Ich stelle auf meiner Homepage für beide Dimensionen mein "Hinterkopf-Modell" vor, hier für die Sachebene das FSD-Modell. Es besteht aus drei Kategorien:
Fachwissen - Systematik - Dynamik/Disziplin
Das Vorgehen ist einfach. Überlegen Sie sich, wie die drei Kategorien im vorliegenden Fall ausgeprägt sind: wie gut ist das gezeigte Fachwissen, wie systematisch wird vorgegangen und ist man dynamisch und diszipliniert? Nehmen Sie diese drei Bewertungen vor, sie ergeben ein Gesamturteil. Jetzt haben Sie ein Urteil, dass nicht auf einem allgemeinen Eindruck basiert, sondern dass Sie strukturiert anhand dreier wichtiger Kategorien erarbeitet haben.
Dass die Kategorie Fachwissen wichtig ist, versteht sich von selber. In den meisten Fällen ist es vorhanden. Zu klären bleibt, ob das in ausreichendem Maß der Fall ist und ob etwa das Fachwissen auf dem aktuellen Stand ist oder veraltet ist. Eines ist klar: Wenn das Fachwissen fehlt, kann man in dem betreffenden Bereich nicht viel retten.
Doch häufig mangelt es an den beiden anderen Kategorien. Sie haben etwa einen exzellenten Ingenieur. Leider arbeitet er nicht am Hauptproblem, sondern an einem weniger wichtigen Thema. Ein Werk optimiert nicht den zeitkritischen Prozess, sondern einen anderen. Der Lieferant hat viele gute Ideen, leider kein gutes Qualitätssicherungssystem. Die Systematik ist eine der Stärken der Lean-Methode, ob Lean Production oder Lean Administration. Durch kleine, aber systematische Schritte wird z. Bsp. sichergestellt, dass Probleme transparent gemacht, priorisiert werden und nachhaltig abgestellt werden. Durch Systematik werden sprudelnde Ideen in ein konsistentes Konzept übergeführt.
Bei vielen Einheiten fehlt es an Dynamik und Disziplin, ein Thema typisch für große "marktfernere" Bereiche, doch bei weitem nicht nur dort. Man arbeitet - nicht böswillig, sondern weil man so sozialisiert wurde - sehr gemächlich, gründlich und ausführlich. Oder die zu lösenden Punkte werden angegangen, aber nur zum Teil abgeschlossen. Ein häufiger Fehler ist, an zu vielen Themen gleichzeitig zu arbeiten, mit der Folge, dass man sich verzettelt. Besser ist es also, etwa drei Themen anzufangen und abzuschlieén, bevor die nächsten Themen angepackt werden. Wenn Dynamik und Disziplin fehlen, führen selbst Fachwissen und Systematik nicht zum Ziel.
Das Hinterkopf-Modell FSD betrifft den sachlichen Teil der Arbeit von Personen, Gruppen oder Betrieben. Wichtig ist auch der emotionale Teil der Arbeit. Das erläutere ich in einem weiteren Blog.
Kosten senken
Viele Branchen haben in unserer Marktwirtschaft einen scharfen Wettbewerb. Die Autobranche gehört zweifellos dazu. Im Geschäft mit den Erstausrüstern (also den Autoherstellern) müssen die
Zulieferer große Stückzahlen zu einwandfreier Qualität liefern – und dann müssen sie mit den Marktpreisen klarkommen, was eine besondere Herausforderung ist. Wenn ein Zulieferer mit einem
Erstausrüster einen Vertrag über die Lieferung einer Komponente schließt, so läuft dies anders ab, als ein Außenstehender meinen könnte. Denn zum einen vergehen zwischen Vertragsabschluss und
Lieferstart gute drei Jahre. In dieser Zeit wird das Produkt ins Detail spezifiziert und entwickelt, es werden Muster gebaut, Tests auf Prüfständen und im Fahrzeug durchgeführt etc. Zum anderen
weist die vereinbarte Preiskurve regelmäßig nach unten. Das heißt zum Beispiel, dass im Jahr nach dem Produktionsanlauf ein Preis bei 100 liegt, dann aber Jahr für Jahr fällt, auf 98 und 95 und
93 oder so ähnlich.
Klar, dass die Zulieferer diese Preiskurve bei ihren Kosten nachfahren müssen, sonst würde der Ertrag sinken. Die Zulieferer versuchen natürlich, diese Preissenkungen an ihre Lieferanten
weiterzugeben, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und sie müssen die Kosten ihrer eigenen Wertschöpfung senken. Da gibt es Effekte, die zusätzlich belasten, so die Lohnsteigerungen, steigende
Energiepreise und anderes mehr. Und da gibt es Effekte, die helfen: der Stückzahl-Hochlauf führt über die Fixkosten-Allokation zu geringeren Stückkosten. Innovationen helfen, die Produkte
einfacher zu gestalten, sie günstiger zu produzieren oder Prozesse zu verbessern, z. B. neue IT-technische Lösungen in der Logistik.
Den Rest der Kostensenkung müssen die Zulieferer durch ständige Verbesserungen bei allen Kostenfaktoren erreichen. Betrachten wir die Personalkosten. Am Anfang prüfen die Firmen, ob es Aufgaben
gibt, auf die man verzichten kann. Solche Potenziale zu finden, ist ebenso attraktiv wie selten. Denn die Zulieferer haben solche Kostensenkungsprozesse mehrfach durchlaufen, die einfachen
Lösungen wurden bereits gefunden. Man muss also immer stärker nach nicht naheliegenden Ansätzen suchen. Ein Beispiel ist die Flexibilität im Personaleinsatz. Oftmals gelten Regelungen, ob
gesetzlich, tariflich oder betrieblich, die bei den Arbeitgebern Kosten verursachen, ohne dass das Geld in den Taschen der Mitarbeiter landet.
Ein Beispiel ist die Frist, in der Produktionsschichten angesetzt oder abgesagt werden können. Dies ist betrieblich geregelt. Erfährt ein Unternehmen von einem Minderbedarf eines Kunden erst zwei
Tage vor dem betreffenden Produktionstermin, muss die Schichten aber eine Woche vorher gegenüber den Mitarbeitern absagen, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Produkte auf Halde zu
produzieren. Dies führt zu höheren Lagerkosten oder auch zu Zusatzkosten für Ersatzverpackung u. a. m. Im Einzelfall sind die Zusatzkosten vielleicht nicht allzu hoch, geschieht dies häufiger, so
summieren sich die Zusatzkosten doch zu erheblichen Beträgen.
Ein anderes Beispiel ist das Arbeitszeitgesetz. Es soll die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleisten, gilt im Übrigen – überraschend für ein Schutzgesetz - nicht für leitende
Angestellte. Eine Regelung ist die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf 10 Stunden, unter der Prämisse, dass über einen längeren Zeitraum ein Durchschnitt von 8 Stunden nicht überschritten
wird. Auch für diese Regelung gibt es Ausnahmen. Sie sind aber nicht eindeutig geregelt und schaffen Unsicherheit in den Betrieben. Hinzu kommt, dass ein Verstoß gegen das Gesetz sogar als
Straftat bewertet werden kann. In solchen Fällen kommen häufig erhebliche Mehrkosten zustande.
Ruhezeiten sind ein anderes Problem. Vorgeschrieben ist, dass nach der täglichen Arbeitszeit eine Ruhezeit von 11 Stunden einzuhalten ist. Wird beispielsweise ein Mitarbeiter des
Facility-Managements nachts um 4:00 Uhr in die Firma gerufen, um eine Störung an einer Anlage zu beseitigen, und ist gegen 4:30 Uhr wieder daheim, so darf er erst 11 Stunden später, also um 15:30
Uhr seine normale Arbeit antreten. Er fällt also fast den ganzen Arbeitstag aus, fehlt etwa bei vereinbarten Terminen und stört dadurch die betrieblichen Abläufe. Auch den Mitarbeitern passt
diese Regel häufig nicht, denn sie müssen die Fehlstunden zu ungünstigen Zeiten am Abend oder gar am Wochenende nachholen. Verwiesen sei auch auf das immer häufiger praktizierte Home-Office, bei
dem es ohnehin sehr schwierig ist, die Arbeitszeiten in das enge Raster des Arbeitszeitgesetzes zu bringen.
Hier muss der Gesetzgeber praxisnah handeln und die Regeln an die sich ändernde Arbeitswelt und die Erfordernisse der Unternehmen anpassen. Er hat genug Spielraum dafür, ohne die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer zu beeinträchtigen.
Diese Beispiele zeigen, dass es das tägliche Brot der Unternehmen ist, ihre Kosten zu senken, indem Prozesse systematisch überprüft und verbessert werden. Es gibt viele Ansätze hierfür. Ein
Beispiel ist das aus Japan stammende Verfahren der schlanken Produktion (Lean Production) bzw. der schlanken Verwaltung (Lean Administration). Was für die Unternehmen selbstverständlich ist,
sollte auch bei den Behörden praktiziert werden. Denn diese haben den Auftrag, ihre Arbeit so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten, um dadurch mit dem Steuergeld der Bürger
wirtschaftlich zu haushalten. Leider ist hier noch Vieles im Argen.
Energiemanagement-System
Energie sparen ist wichtig, auch für Unternehmen. Wer würde dieser Aussage widersprechen? Niemand, sollte man annehmen. Ist doch der sparsame Umgang mit Ressourcen eine völlig normale Aufgabe des
Unternehmens, um Kosten zu sparen. Doch wie soll das Energiesparen praktiziert werden? Unser Staat hat da eine klare Meinung. Er möchte den Unternehmen vorschreiben, wie sie das tun. Um in den
Genuss des so genannten Spitzenausgleichs zu kommen, müssen die Unternehmen ein Energiemanagementsystem aufbauen.
Erinnern wir uns. 1999 wurde die Stromsteuer eingeführt und mit Wirkung ab 2013 geändert. Die Einnahmen aus der Stromsteuer verwendet der Staat zu 90% zur Senkung der Beiträge zur gesetzlichen
Rente. Unternehmen, die bei dabei schlecht abschneiden – weil sie relativ viel Energie verbrauchen und wenige Mitarbeiter haben, also viel Stromsteuer zahlen und wenig von der Senkung der
Rentenbeiträge profitieren – können durch den Spitzenausgleich entlastet werden, aber nur wenn sie ein Energiemanagementsystem einführen und sich von akkreditierten Auditoren zertifizieren
lassen.
Das Energiemanagement ist genau geregelt. Denn es ist durch eine internationale Norm definiert, die ISO 50001. Darin wird detailliert vorgeschrieben, wie das Unternehmen Energie sparen muss. Es
wird geregelt, wie die strategischen und operativen Ziele zu definieren sind, wie die Maßnahmenpläne zu gestalten sind, und ebenso die Planung, die Umsetzung und das Betreiben des Systems, das
Überwachen und Messen von Anlagen. Die Dokumentations-pflichten sind erheblich. Wer die Zertifizierung in der Praxis erlebt, empfindet sie als ziemlich formalistisch und bürokratisch. Es wird
mehr gefragt „Werden Maßnahmen definiert?“ als „Wie sinnvoll sind die Maßnahmen, die definiert werden?“. Nun, gewiss ist auch etliches Sinnvolles dabei, das will ich nicht abstreiten. Es gibt
aber viele Ungewissheiten. Wie soll man ein Energie-Einsparungsziel für das nächste Jahr objektiv definieren? Was heißt -1,5%? Bei dem einen Unternehmen wächst der Umsatz, beim anderen sinkt er.
Wenn ein Unter-nehmen mehrere, unterschiedlich energieintensive Produkte fertigt, wie berücksichtigt man dann im Wert für das Gesamtunternehmens die veränderte Anteile der Produkte am Umsatz?
Fragen über Fragen. Wer mit dem Thema nicht vertraut ist – und das sind viele – kann übrigens Berater engagieren, die sich in der Auditierung auskennen, evtl. weil sie selber Auditoren sind.
Die Auditoren und das Zertifizierungsaudit kosten einiges an Geld, auch erheblicher interner Aufwand fällt an: für Energiemanagement-Beauftragte, interne Audits, Schulungen, Freistellungen und
anderes mehr. Ein mittleres Unternehmen ist da schnell bei 20.000 € bis 30.000 € Gesamtkosten im Jahr. Zwar gibt es für kleine Unternehmen ein vereinfachtes Verfahren, doch die
volkswirtschaftlichen Kosten des Energiemanagementsystems liegen gewiss bei mehreren 10 Millionen €.
Mittlerweile ist ein zertifiziertes Energiemanagementsystem auch für die Entlastung bei der EEG-Umlage Voraussetzung. Das Bedenkliche am Energiemanagement ist, dass der Staat den Unternehmen unter Androhung, den Spitzenausgleich zu verpassen, vorschreibt, wie sie ihre Arbeit zu machen haben und dass sie sich zertifizieren lassen müssen. Mag sein, dass Politiker sich gut in der Öffentlichkeit präsentieren können, wenn sie verkünden: „Ich habe diese und jene Maßnahme zum Energiesparen durchgesetzt“. Aber letztlich ist das ein unnötiger Eingriff in die Autonomie der Unternehmen. Mit dem gleichen Recht könnte sich der Staat in das Sparen bei anderen Unternehmensressourcen einmischen und ein entsprechendes Managementsystem plus Auditierung vorschreiben.
Fazit: Jedes Unternehmen wird sich im eigenen Interesse um die effiziente Nutzung der Energie bemühen und braucht nicht den Staat als Nachhilfelehrer. Wenn das Unternehmen externes Know-How
braucht, kann es Berater anheuern. Ein Unternehmen, das seine Hausaufgaben nicht macht, wird im Rahmen unserer Marktwirtschaft sanktioniert, nämlich vom Wettbewerb. Und dabei sollte es bleiben.
Rasch und fundiert urteilen - das zweite "Hinterkopf-Modell" AMK

Dieser Blog handelt wie der letzte von der zentralen Führungsaufgabe, dem schnellen Urteilen über eine Person, eine Gruppe, einen Bereich, ein Werk oder einen Lieferanten - und das mit Hilfe eines "Hinterkopf-Modells", also einer "Heuristik", einem einfachen Schema, das Ihnen ein rasches und fundiertes Urteil ermöglicht. Beim FSD-Modell geht's um die "hard facts", geprüft an den Kategorien Fachwissen, Systematik und Dynamik/Disziplin. Hier geht es um die "soft facts", die emotionalen Aspekte, die eine entscheidende Wirkung auf die Effektivität einer Einheit haben.
Ich nutze wieder ein Modell von drei Kategorien. Es sind das Arbeitsklima, die Motivation und die Kooperation(-sbereitschaft).
Das Arbeitsklima spüren Sie, wenn Sie mit einer Gruppe zu tun haben. Ist es offen und konstruktiv? Merkt man, dass die Mitarbeiter gern hier arbeiten und dass sie gut zusammenarbeiten oder spüren Sie ganz schnell eine Hackordnung, die nur den Chef sprechen lässt und derzufolge die Mitarbeiter erkennbar den Mund zu halten haben? Der Führungsstil spielt beim Arbeitsklima eine wichtige Rolle. Grüßt der Geschäftsführer beim Rundgang die Mitarbeiter in der Produktion oder gibt es offensichtlich keine Kommunikation? Wird offen über Probleme und Rückschläge gesprochen oder wird Ihnen eine "dog-and-pony-show" vorgeführt? Das Arbeitsklima sollte positiv sein, es darf aber nicht zur Komfortzone werden, sondern muss leistungsorientiert sein. Auch darauf ist zu achten.
Konkret wird es bei der Motivation der Mitarbeiter. Und sie wird sowohl bestimmt von der Einstellung der Mitarbeiter als auch von ihrer Einbindung durch die Führung. Bei der Motivation unterscheidet man extrinsische und intrinsische Faktoren. Extrinsisch ist Geld, vor allem in Form von Incentives. Die herrschende Meinung sieht dies aber als "Hygienefaktor", d. h. es schadet, wenn es fehlt, aber die Wirkung ist begrenzt. Auch die Aussicht auf Beförderung oder öffentliches Lob sind extrinsisch. Die intrinsische Motivation hat mehr Potential. Sie beruht zum einen auf der Freude an der Arbeit und zum anderen, inwieweit die Arbeit dem Mitarbeiter erlaubt, seine persönlichen Werte und Ziele zu verfolgen. Auch die Führung kann viel tun, damit die Mitarbeiter motiviert sind: Sie muss diese einbinden. Das geschieht durch Wertschätzung und durch ausführliche Information über den Zweck der Arbeit oder eines Projekts. Wichtig ist eine Regel-Kommunikation, nicht nur als Information durch die Führungskraft, sondern auch als Feedback der Mitarbeiter.
Eine dritte, wichtige Kategorie ist die Kooperation(-sbereitschaft). Die Kooperation zwischen Gruppen, Abteilungen oder ganzen Bereichen krankt häufig. Oft gibt es Konflikte. Das sind unter-schiedliche Schwerpunkte, Interessen, aber auch Persönliches. Der Einkauf hat andere Ziele als die Produktion, die Entwicklung ist anders ausgerichtet als der Vertrieb. Es gibt Kämpfe um Budgets. Aus Distanz zu anderen Bereichen resultiert oft Animosität. Die oberen Führungskräfte müssen ihren Führungskräften die Kooperaton explizit zur Aufgabe machen und sie auf die Agenda von Rücksprachen und Beurteilungsgesprächen setzen. Zweckmäßig ist es, bei kooperierenden Einheiten engen persönlichen Kontakt durch räumliche Nähe - etwa in einem funktionsübergreifenden Büro - oder durch gemeinsame Feiern zu fördern. Auch eine - konstruktive - Eskalation kann nutzen. Konflikte werden rasch auf die Ebene transportiert, die diese Konflikte lösen kann. Es wird dadurch verhindert, dass Konflikte "schwelen" und zum Dauerthema werden.
Also, überlegen Sie sich, wie diese drei Kategorien im konkreten Fall ausgeprägt sind, und Sie kommen zu einem raschen und fundierten Urteil über die "soft facts".
Wie sollen wir mit Risiken umgehen?
Unser Leben ist bekanntlich voller Risiken. Wir gehen sehr unterschiedlich mit ihnen um. Manche Risiken nehmen wir bewusst in Kauf, andere Risiken versuchen wir zu reduzieren, noch andere komplett zu vermeiden. Dass wir in unserem Risikoverhalten konsistent sind, kann man getrost bezweifeln.
Den Risiken stehen Chancen oder Nutzen gegenüber. Klassisch ist der Fall in der Geldanlage. Eine deutsche Staatsanleihe ist nahezu risikolos, dafür bekommt man wenig Zinsen, im Moment noch
weniger als sonst. Eine Aktie dagegen hat eine deutlich höhere Chance auf Ertrag. Zugleich hat sie ein deutlich höheres Risiko.
Auch der Staat beschäftigt sich mit Risiken. Über zahllose Vorschriften regelt er, wie er mit den Risiken umgeht und wie die Bürger mit den Risiken umzugehen haben. Das Autofahren führt in
Deutschland im Jahr zu rund 3.000 Toten, früher waren es deutlich mehr. Dieses „Restrisiko“ nehmen wir in Kauf. Motorradfahren ist 20mal gefährlicher. Auch das ist erlaubt. Von den schon
„Risiko-Sportarten“ genannten Freizeitvergnügen wir Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen oder Wingsuit-Fliegen mal ganz abgesehen. Auf der anderen Seite lesen wir, dass Brandschutzbestimmungen
immer mehr verschärft werden, mit der Folge, dass öffentliche Bauten immer teurer werden – man denke nur an den geplanten Berliner Flughafen BER – oder Neubauten nicht durchgeführt werden, da die
neuen Brandschutzbestimmungen zu nicht-finanzierbaren Mehrkosten führen und man dann lieber beim alten – risikoreicheren – Zustand bleibt.
Um mit den Risiken rational umgehen zu können, müssen wir sie nicht nur kennen, sondern wir müssen sie bewerten können. Es würde ja wenig sinnvoll sein, in dem einen Fall ein hohes Risiko
einzugehen und im anderen Fall nur ein geringes Risiko. Aber wie kann man Risiken bewerten und auf diese Weise zu einem stimmigen Risikokonzept kommen?
Schauen wir in die Industrie. Dort gibt es ebenfalls viele Risiken und es gibt eine Methode bei Neuentwicklungen oder Änderungen von Produkten und Prozessen, Fehler früh zu ermitteln und
möglichst zu vermeiden. Zu diesem Zweck werden die Risiken systematisch bewertet. Diese Methode heißt „FMEA“, ausgeschrieben „Failure Mode and Effect Analysis“. Dies wurde ins Deutsche etwas
ungelenk übersetzt als „Fehlereinfluss- und -möglichkeitsanalyse“. Das Prinzip ist einfach. Man bewertet zum einen, wie wahrscheinlich es ist, dass das Risiko eintritt, und zum anderen, wie groß
seine Auswirkung ist. Aus der Multiplikation der in Zahlen ausgedrückten Ausprägung der beiden Kriterien ergibt sich eine Risiko-Kennzahl.
Wenden wir das auf ein Beispiel aus der Umweltschutzpolitik an. Wenn ein Gefahrstoff A eine hohe schädigende Wirkung auf die Gesundheit hat, muss man durch Maßnahmen, etwa den Einbau von Filtern
an seiner Quelle, die Eintrittswahrscheinlichkeit so stark reduzieren, dass die Risiko-Kennzahl auf dem akzeptablen Niveau anderer Risiken B und C liegt und damit „tragbar“ ist. Wenig sinnvoll
wäre es, bei Risiko A die Eintrittswahrscheinlichkeit und dadurch die Risiko-Kennzahl, durch hohen Aufwand weit unter die Werte der Risiken B und C zu treiben. Sinnvoller ist es die
Risiko-Kennzahlen aller drei Werte gleichermaßen zu senken. Derartige Ansätze zum Umgang mit Risiken lassen sich auf andere Bereiche wie Brandschutzbestimmungen oder auf die öffentliche
Sicherheit übertragen.
Es mag im Einzelfall geradezu makaber klingen, dass man bestimmte Restrisiken akzeptieren soll. Doch da es bei solchen Fragen immer darum geht, die knappen öffentlichen Gelder sinnvoll auf die
verschiedenen Zwecke zu verteilen, sollten wir systematisch vorgehen. Wir sollten Risiken bis zu einem gewissen Grad begrenzen, ein darüber hinausgehendes Restrisiko aber akzeptieren. Durch ein
systematisch angewandtes übergreifendes Risikokonzept mit der Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung der Risiken erreicht eine Gesellschaft im Ergebnis insgesamt eine
risikoärmere Lebensweise.
Frauen im Unternehmen
Viele in unserer Gesellschaft sehen die Unternehmer* und Manager* äußerst negativ und machen ihnen massive Vorwürfe. Der Schwerste ist, dass die Unternehmer und Manager nur ans Geld denken, alles
ihrer Gier unterordnen und keine Moral haben.
Ein weiterer Vorwurf ist, dass die Unternehmer und Manager – und hier sind nur die männlichen gemeint – Frauen systematisch benachteiligen. Viele Fälle werden angeführt. In einem Volk mit 80
Millionen Angehörigen gibt es natürlich für jeden Vorwurf Beispiele. Die Frage ist, sind das Einzelbeispiele oder ist das systematisch?
Zunächst fällt auf, dass die beiden Vorwürfe sich widersprechen. Denn wer schlechtere Männer besseren Frauen vorzieht, verdient tendenziell weniger Geld. Ein Unternehmer oder Manager, der nur ans
Geld denkt, kann seine Mitarbeiter nicht nach dem Geschlecht diskriminieren, übrigens auch nicht nach Herkunft, dem Aussehen oder sonstiger Orientierung.
Nehmen wir mal an, den Unternehmern und Managern ist die Diskriminierung von Frauen wichtiger als alles andere. Die härtesten Kritikerinnen führen stets Männerbünde und -gemeinschaften an, die
sich gemeinsam gegen Frauen geradezu verschwören. Demnach müssten sich die Männer vor Entscheidungen über Einstellungen, Beförderungen oder Gehaltserhöhungen in geheimen Vorbesprechungen oder
informell verabreden, die Kandidatinnen zu benachteiligen. Solche Vorstellungen sind schon sehr abstrus und von der Praxis in den Betrieben weit entfernt.
Überdies liegt dieser Position die Perspektive zugrunde, dass das Geschlecht die einzig relevante Eigenschaft von Personen ist. Die Menschen, männlich und weiblich, in ihrer Vielfalt von
Eigenschaften, Wissen, Erfahrungen, Verhalten und Handeln werden ausschließlich nach dem Geschlecht kategorisiert. Das ist im Übrigen ein strikt kollektivistischer Ansatz. Die Individuen werden
nicht als einzelne Personen gesehen, sondern nur als Mitglied einer Gruppe, hier des Geschlechts.
Doch gibt es in den Unternehmen statt der „harten“ eben die „softe“ Benachteiligung von Frauen? Werden die männlichen Attribute wie Durchsetzungskraft, Entschlossenheit und Härte höher geschätzt
als die weiblichen Attribute wie Konsensdenken, Einfühlsamkeit und Bescheidenheit, so dass die Männer dadurch – vielleicht nur unbewusst – bevorzugt werden? Hier mag es Hürden für Frauen geben.
Allerdings ist auch klar, dass sich die Gesellschaft und die Unternehmen erheblich geändert haben und weiter ändern. Dasselbe gilt für die Frauen. Sie sind mutig geworden und selbstbewusst. Diese
Veränderungen sind massiv, es braucht aber Zeit, bis sie sich in allen Bereichen durchsetzen.
In vielen Betrieben gibt es Frauenförderprogramme. Sie enthalten individuelle Unterstützung von Frauen durch Weiterbildung, Coaching und Frauengruppen. Darüber hinaus legen viele Unternehmen
Frauenquoten für die Hierarchiestufen fest. Das kann ein Unternehmen im Rahmen seiner Eigenverantwortung tun. Allerdings wird dies fragwürdig, wenn die Frauenquote höher ist als der Anteil der
Frauen an den relevanten Bewerbergruppe. Wer also bei 15% Frauenanteil bei Bewerbungen für Ingenieursstellen 25% Frauenanteil für die Einstellung vorgibt, begibt sich ins Dickicht neuer
Diskriminierung.
Wie gesagt, wenn ein Unternehmen im Rahmen seiner Eigenverantwortung so vorgeht, ist das – bis zu einem gewissen Ausmaß – dessen Sache. Wenn der Staat aber Frauenquoten vorgibt, wie sie in
Deutschland für die Aufsichtsräte etliche Unternehmen gelten, so ist das in dreifacher Hinsicht zu kritisieren. Erstens kann nicht eine vermeintliche Diskriminierung durch eine „kompensierende
Diskriminierung“ ersetzt werden, zumal im Grundgesetz das Diskriminierungsverbot sich auf Individuen bezieht und nicht auf Gruppen. Zweitens ist eine Quote ein Eingriff in die unternehmerische
Freiheit. Und drittens äußert sich in den bürokratischen staatlichen Umsetzungsvorschriften der Quoten und der Frauenförderung eine Einstellung, bei der bürokratische Regeln als geeignetes Mittel
angesehen werden zur Umgestaltung von Unternehmen. Die hohen Kosten und Ineffizienz dieser Bürokratie werden aber missachtet.
Es bleibt zu hoffen, dass in Politik und Regierung endlich wieder Praxisnähe und Augenmaß über kollektivistische Ideologie dominieren und dass in den Unternehmen der gesellschaftliche Wandel
voranschreitet und Reste möglicher Benachteiligung endgültig verschwinden.
* Es sind stets männliche und weibliche Vertreter gemeint.
Der relevante Markt für die Entscheidungen der Politik
Wenn Unternehmen ihre Strategie festlegen, ist als Erstes auf die Frage zu antworten, was im Wettbewerb ihr relevanter Markt ist. Wer sind die Konkurrenten, welche Regeln gelten und welche Effekte wirken? Welche Produkte und Dienstleistungen konkurrieren? Dies gilt für den Absatzmarkt, aber gleichermaßen für die Märkte für die Beschaffung von Materialien und für die Rekrutierung von Mitarbeitern. Nur wenn ein Unternehmen die relevanten Märkte kennt, kann es zielgerichtet agieren.
Im Grundsatz ist das in der Politik nicht anders. Eine Regierung muss überlegen, welche Wirkungen ihre politischen Entscheidungen haben und wie die Entscheidungen anderer Länder auf ihr Land
wirken. Andernfalls wird sie falsche Entscheidungen treffen. Im Falle Deutschlands stellt sich die Frage, ob die alte und vermutlich neue Bundesregierung diesen „relevanten Markt“ systematisch
identifiziert und zur Grundlage ihrer Entscheidungen macht. Dieses Vorgehen ist zweckmäßig für die Politik als Ganzes und für viele Politikbereiche, etwa den Umweltschutz, die Außen- und
Sicherheitspolitik, die Wirtschafts- und Finanzpolitik u. a. m.
Die Gesamtheit der politischen Entscheidungen der Bundesregierung kann man als „Angebot“ an die Bürger Deutschlands verstehen, wie diese ihr Leben gestalten können. Wenn jetzt die Regierung ein
sehr unattraktives „Angebot“ macht und der „relevante Markt“ allein Deutschland umfasst, weil das Land „abgeriegelt“ ist, die Bürger also das Land nicht verlassen dürfen, hat dies in diesem Sinn
keinen negativen Effekt. Wenn das Land aber offen ist und der relevante Markt die gesamte EU ist und andere Staaten umfasst, dann können die Bürger auf das schlechte „Angebot“ reagieren und das
Land verlassen bzw. ausländische Personen können daraufhin entscheiden, nicht nach Deutschland zu kommen. Seit etlichen Jahren hat Deutschland eine Netto-Auswanderung an Akademikern. Also wird
der „relevante Markt“ offenbar nicht erfolgreich bearbeitet.
Ein Fall aus dem Umweltschutz: In der EU besteht für die Stromerzeugung und einige Industriebranchen ein Handel mit Verschmutzungsrechten, den CO2-Emissionszertifikaten. Dabei definiert die EU
einen maximalen erlaubten Ausstoß an CO2, der Jahr für Jahr um 1,7% reduziert wird; die Verschmutzungsrechte können gehandelt werden. Deutschland hat zusätzlich bei den Erneuerbaren Energien ein
staatlich gesteuertes System etabliert, das Betreibern von Photovoltaik und Windkraft auf 20 Jahre Subventionen garantiert, wofür die Stromkunden über 25 Mrd. im Jahr zahlen müssen. Alle – extrem
teuer erkauften – positiven CO2-Reduzierungseffekte des EEG-Systems in Deutschland verpuffen allerdings im EU-Emissionshandel. Das bedeutet, dass die deutsche Regierung hier – wissentlich – den
falschen „relevanten Markt“, nämlich Deutschland definier – der richtige wäre die EU – mit der Folge, dass extrem viel Geld ausgegeben wird, der CO2-Ausstoß aber nicht sinkt.
Auch andere Effekte sind beim Umweltschutz zu beachten. Nehmen wir den Fall, dass ein deutscher Autozulieferer bei einem energieintensiven Produkt wie einem Aluminium-Druckgussteil wegen
staatlich in die Höhe getriebener Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Sein Kunde kauft nicht national, sondern international ein. Er wird folglich seine Gehäuse in Zukunft nicht mehr
beim deutschen Zulieferer beziehen, sondern bei einem Hersteller aus einem Land, in dem die Energiekosten niedriger sind als in Deutschland. Effekt Nr. 1 ist, dass die Wertschöpfung und die
Arbeitsplätze der Gehäuseproduktion in Deutschland verloren gehen und ins Ausland abwandern. Effekt Nr. 2 kann sein, dass der ausländische Zulieferer wegen der niedrigeren Energiekosten einen im
Vergleich zu Deutschland energieintensiveren Prozess anwendet und dass dann die Entscheidung der Bundesregierung nicht nur keine CO2-Reduzierung bewirkt, sondern sogar eine Erhöhung des
CO2-Ausstoßes.
Ein Beispiel aus der Finanzpolitik: Vor den Verhandlungen zur neuen CDU/SPD-Koalition beschloss US-Präsident Trump eine Steuerreform, mit der die Steuern auf die Unternehmensgewinne in den USA
von 35% auf 20% gesenkt werden. Es ist klar, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben wird, die 30% Steuern zu zahlenhat. Doch die US-Steuerreform spielte in den
CDU/SPD-Verhandlungen keine Rolle. Offenkundig gehören die USA auf dem Gebiet des internationalen Steuerwettbewerbs für die CDU/SPD-Regierung nicht zum „relevanten Markt“.
Die Beispiele zeigen – und es ließen sich viele weitere anführen – dass die Bundesregierung, ob bewusst oder unbewusst, die Frage, welches der relevante Markt für ihre Entscheidungen ist, nicht
angemessen beantwortet.